Teile das Video
Teile das Video mit deinen Bros für noch mehr Fun zusammen!
Weiter Videos findest du hier.
Beschreibung der Videos
Präsentiert wird eine Turmaufnahme der Kulturkirche St. Johannis in Hamburg-Altona. Der schmale 83 Meter hohe Turm ist schon von weitem zu sehen und sehr auffällig. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte man, der Kirche ein neues Gesicht zu geben: mit einer dem Prinzip der Schlichtheit verpflichteten Modernisierung. Dabei wurde leider mehr zerstört als gewonnen. Erhebliche Schäden durch eine Brandstiftung im Sommer 1994 machten zum Ende des vergangenen Jahrhunderts eine umfassende Sanierung und Renovierung nötig. Dabei wurde die Gemeinde unterstützt von der Hamburger Denkmalpflege und der ALH (Arbeit und Lernen Hamburg GmbH), einem bedeutenden sozialpolitischen Unternehmen, finanziert u.a. von der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales und von der Europäischen Union. Die gemeinsame Arbeit von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen bei dieser Sanierung war einen wichtiger Baustein für ein weiteres Verständnis zur neuen Kirchennutzung.Auch die Orgel wurde durch den Brand völlig zerstört. Seit 1998 erklingt eine von der Firma Kuhn neu erbaute Orgel in St. Johannis, die zu den bedeutendsten Instrumenten in Norddeutschland zählt.
Der Turm beherbergt ebenfalls einen weiteren historischen Schatz. Dieser besteht aus drei Glocken, welche im Jahre 1872 vom Bochumer Verein gegossen wurden. Somit stellt es eines der frühen Werke aus Bochum dar.
Alle Glocken hängen in einem Holzglockenstuhl an geraden Jochen. Dabei besitzt jedoch die kleinste der drei Glocken einen Fallklöppel und die beiden Großen einen Schwungklöppel.
Das Geläut insgesamt hat einen interessanten Klangcharakter, wenn auch es leider nur selten erklingt. Die Glocken haben dennoch eine tolle und angenehme Ausstrahlung.
Glocke 1 | ais°±0 | 2.500kg | d=1.900mm | BVG 1872
Glocke 2 | d'+2 | 1.500kg | d=1.600mm | BVG 1872
Glocke 3 | e'+2 | 930kg | d=1.330mm | BVG 1872
Quellen:
-Text: Gemeindeseite St. Johannis Hamburg Altona, eigene Informationen
-Bilder: Eigene Dateien
Ein ganz großes Dankeschön geht an die Gemeinde St. Johannis für die Erlaubnis, das Geläut gesondert dokumentieren zu dürfen, sowie die Zusage zum Veröffentlichen der Aufnahmen.
Desweiteren möchte ich mich bei dem Hilfsküster für das Aufschließen des Turmes, sowie für die netten Gespräche danken.
Ein weiteres großes Dankeschön geht an Petersglocke für den tollen Tag, aber auch für die tatkräftige Aufnahmeunterstützung!
Es war klasse! :-)
Glockentürme und Glockenstuben sind keine öffentlicher Zugang. Diese Aufnahme wurde organisiert und die Videos unter der Einverständniserklärung der jeweiligen Gemeinde erstellt und veröffentlicht.
Bei der Verwendung meiner Videos bin ich als Urheber darüber in Kenntnis zu setzten. Ebenfalls benötigt der User anschließend meine Genehmigung für die anschließende Verwendung der Aufnahmen.
(c) Angelusglocke 2019
Aufnahmedatum: Montag, 12.08.2019 zu einem Sonderläuten.
Die Gethsemanekirche ist eine evangelische Kirche im Berliner Bezirk Pankow und steht im Helmholtzkiez des Ortsteils Prenzlauer Berg. Sie wurde 1891–1893 nach Plänen von August Orth erbaut und verdankt ihre Bedeutung nicht zuletzt ihrer Rolle während der friedlichen Revolution in der DDR im Herbst 1989. Sie ist im 21. Jahrhundert eine von drei von der Evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord im Kirchenkreis Berlin Stadtmitte genutzten Kirchen sowie eine von vier Predigtstätten.
LAGE UND UMFELD:
Die Gethsemanekirche steht an der Stargarder Ecke Greifenhagener Straße im Norden des Ortsteils Prenzlauer Berg, rund 100 m östlich der Schönhauser Allee in der Nähe des gleichnamigen Ring- und U-Bahnhofs. Die Kirche ist nach Osten ausgerichtet, der Westturm bildet die Schaufassade zur genannten Straßenkreuzung hin. Die Gethsemanestraße umschreibt den Chor und die Nordseite der Kirche und bildet mit den anderen beiden Straßen einen Platz, in dessen Mitte die Kirche steht.
Die Fassaden der den Platz begrenzenden Wohnhäuser gehören zu den prächtigsten in Prenzlauer Berg, einem als Arbeiterviertel entstandenen Bezirk, der im Vergleich zu den westlichen Gründerzeitbezirken Berlins, etwa Charlottenburg oder Schöneberg, weniger repräsentativ gestaltete Wohnhäuser aufweist.
Die Kirche bildet eine markante städtebauliche Dominante, die Stargarder Straße besitzt in Höhe der Kirche einen leichten Knick, sodass der Turm im ganzen Verlauf der Straße am Ende der Sichtachse zu sehen ist.
Die Wohnviertel der Umgebung, die
Quartiere Helmholtzplatz und Falkplatz, erlebten seit 1990 einen weitgehenden Austausch der Bevölkerung, diese besteht heute aus weit überdurchschnittlich vielen jungen Erwachsenen und jungen Familien.
BAUGESCHICHTE:
Das rasante Wachstum Berlins Ende des 19. Jahrhunderts erzeugte großen Bedarf nach immer neuen öffentlichen Einrichtungen für die neu anzusiedelnde Bevölkerung. Im wenig wohlhabenden Norden Berlins, von einfachen, dicht gebauten Wohnhäusern („Mietskasernen“) geprägt, bildeten die Gotteshäuser neuer Kirchengemeinden neben den zahlreich entstehenden Schulen, die einzigen städtebaulichen Dominanten. Die Gethsemanekirche erhielt, wie auch andere evangelische Kirchen, einen repräsentativen Standort auf einem Quartiersplatz, während viele Kirchen, erst recht die katholischen Kirchen mit gewöhnlichen Wohnhausgrundstücken vorliebnehmen mussten.
Zu den größten Grundeigentümern im Norden Berlins gehörte damals Wilhelm Griebenow, der bereits 1823 das große Teile des heutigen Ortsteils umfassende Königliche Vorwerk vor dem Schönhauser Tor erworben und durch Parzellierung und Verkauf des Geländes ein beachtliches Vermögen erwirtschaftet hatte. Seine Witwe Caroline schenkte der Gemeinde das Grundstück an der Stargarder Straße und ermöglichte damit den Bau der Gethsemanekirche. Am 20. März 1891 fand die feierliche Grundsteinlegung statt und schon zwei Jahre später, am 26. Februar 1893, konnte die Kirche eingeweiht werden. Die neue Kirchengemeinde war eine Tochtergründung der Zionsgemeinde, deren Kirche 1866–1873 ebenfalls von August Orth erbaut worden war. Den Namen Gethsemane bestimmte der zur Weihe anwesende Kaiser Wilhelm II. Die Kirche erhielt 1893 eine Orgel von Wilhelm Sauer aus Frankfurt (Oder). Sie besaß 30 Register auf zwei Manualen und dem Pedal.
Im Jahr 1927 erfolgte eine erste Renovierung des Kircheninneren. Bei dieser Aktion erhielt die Gemeinde eine neue Orgel. Die zuerst installierte Sauer-Orgel wurde dabei durch ein Instrument mit elektropneumatischer Traktur aus der Potsdamer Orgelbauwerkstatt von Alexander Schuke ersetzt, das mit 56 Registern auf drei Manualen und Pedal ausgestattet war. Dieses wiederum wich 1973 einer Jehmlich-Orgel mit 25 Registern.
Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Buntglasfenster zerstört und wurden bald nach Kriegsende ersetzt. Im Jahr 1961 gestaltete man den Innenraum komplett um: der Altar rückte aus der Apsis mehr in die Kirchenmitte, die beiden Querschiffe wurden vom Hauptschiff getrennt. Die Wände und Decken erhielten einen weißen Anstrich.
Nachdem im Jahr 2009 Steine vom Turm auf einen Gehweg stürzten, wurde die Gethsemanekirche 2015/2016 für 1,2 Millionen Euro saniert.
GLOCKEN:
Im Turm hängen drei Gussstahlglocken der Glockengießerei Bochumer Verein aus dem Baujahr der Kirche. In einer Inventarliste der Gießerei sind folgende Angaben zu finden: das dreistimmige Geläut kam in eine quadratische Glockenstube, die eine Seitenlänge von 5,60 m hat. Die Herstellung aller drei Glocken samt Zubehör wie Klöppel, Achsen, Lager und Läutehebel kostete 7230 Mark.
b°
des‘
e‘
Vielen Dank an den Kirchwart Herrn Kranz für die Weiterleitung, sowie an den Pfarrer Kuske für die Aufnahmeerlaubnis und an die Gemeindeleitung für die Erlaubnis zum veröffentlichen.
Tags
Mehrere Videos parallel von Angelusglocke, Doktor Meisterpeinlich mit ,
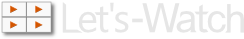



 Springen Zu:
Ton:
Springen Zu:
Ton: