Teile das Video
Teile das Video mit deinen Bros für noch mehr Fun zusammen!
Weiter Videos findest du hier.
Beschreibung der Videos
Es erklingt das große Hochfesteinläuten der katholischen Pfarrkirche Maria Hilf im Münchner Stadtteil Au.Das Große Hochfesteinläuten findet am 24.12., 05.01. und am Samstag vor Pfingsten statt jeweils um 15 Uhr.
Die heutige Kirche ist der 4. Kirchenbau in der Au. Auf dem Heutigen Mariahilfplatz standen 3 Kirchen in unmittelbarer Nähe zueinander. Die errichtete Heilig Kreuz Kapelle ( geweiht 1466) wurde bereits 1817 abgebrochen da sie baufällig war. Ebenfalls befand sich dort das ehemalige Kloster der Paulaner, was nach der Säkularisation zu einer Zuchthauskirche wurde und 1886 durch einen dortigen brannt stark beschädigt wurde. Ein Teil des ehemaligen Klosters wurde nach dem Brand abgerissen und mit dem Konventgebäude zusammen zum Amtsgericht 1902 umgebaut. Heute befindet sich dort das Landratsamt der Stadt München. Die alte Pfarrkirche Maria Hilf befand sich im Norden der heutigen Pfarrkirche. Aufgrund der stark gewachsenen Anzahl an Pilgern wurde die ehemalige Pfarrkirche zu klein. Die ehemalige Maria Hilf kapelle wurde 1629 während dem Dreißigjährigen Krieg geweiht und diente nach der säkularen der Au als Pfarrkirche. 1831 bis 1839 wurde die neue Pfarrkirche errichtet. 1840 nach ihrer Weihe wurde die alte Pfarrkirche (Maria Hilf Kapelle) abgerissen. Somit ist die heutige Kirche Nachfolger aller 3 ehemaligen Kirchenbauten auf dem Maria Hilf Platz. 1926 bis 1928 fanden Sanierungen am Kirchturm statt. Bei einem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg 1944 wurde die Kirche bis auf die Außenmauern zerstört. Lediglich der Turm überstand den Angriff. 1951/52 wurde die Kirche bis auf den Turm in einfacher Form wieder aufgebaut. 1971 musste die alte Turmspitze abgetragen werden, da diese durch den Luftangriff im Zweiten Weltkrieg und der Luftverschmutzung mit der Zeit der Stein mürbe wurde. Bis 1981 wurde die Turmspitze in Beton neu gegossen. Finanziert wurde die heutige Turmspitze durch Spenden der Bewohner der Münchner Au.
Im Turm der Kirche hängen insgesamt 6 Glocken wovon 5 das Hauptgeläut bilden. Das Geläut stammt von Czudnochowsky aus Erding und ist das zweit tontiefste Geläut der Stadt nach dem alten Peter. Seit 2006 besitzen die Glocken Klöppelfänger. Anfang 2012 wurde die untere Glockenstube mit einem Carillon bestückt. 2020/21 wurde die obere Glockenstube mit einem neuen Glockenstuhl aus Holz samt Jochen erneuert. Seit gewisser Zeit befindet sich ebenfalls eine 6. Glocke im Turm. Sie ist historisch und stammte vermutlich aus der ehemaligen Maria Hilf Kapelle. Diese stand vorher im Kirchenraum und wurde durch eine Spende läutbar in den neuen Glockenstuhl der oberen Glockenstube gehängt. Sie wird als Sterbeglocke verwendet. Das Vollgeläut Erklingt an Hochfesten. Ansonsten erklingt ein Teilgeläut je nach Rang des Kirchenjahresangepasst. Der Sonntag wird um 15 Uhr am Samstag mit Einzelglocken und Zusammenläuten eingeläutet. Am Freitag um 15:00 Uhr läutet die Glocke 1 solistisch.
Glocke 1: Salvator ges⁰ Czudnochowsky 1950
Glocke 2: Maria b⁰ Czudnochowsky 1960
Glocke 3: Josef des¹ Czudnochowsky 1960
Glocke 4: Herz Jesu es¹ Czudnochowsky 1960
Glocke 5: Aloysius ges¹ Czudnochowsky 1960
Einzelglocken ab 5:29
Aufnahme vom 05.01.2024 zum Einläuten des Hochfestes Dreikönig um 15:00 Uhr.
Die Christuskirche ist eine evangelisch-lutherische Kirche in Hannover. Sie befindet sich im Stadtteil Nordstadt nordwestlich des Klagesmarktes und wurde 1859–1864 von Conrad Wilhelm Hase als Residenzkirche Georgs V. erbaut. Der neugotische Backsteinbau ist der erste Kirchenneubau Hannovers nach 1747 und Musterkirche nach dem Eisenacher Regulativ, einer 1861 herausgegebenen Empfehlung zur Gestaltung von protestantischen Kirchenbauten, die bis 1890 Bestand hatte. Als Residenzkirche wurde die Christuskirche nur einmal (am Tag der Einweihung) genutzt. Es besteht jedoch bis heute – über das Patronat von Ernst August Prinz von Hannover – Kontakt zum ehemaligen hannoverschen Königshaus.
GESCHICHTE:
Dem Bau der Kirche ging zunächst eine längere Debatte um den Standort voraus. Im Jahr 1858 fiel die Entscheidung für eine Stelle nordwestlich des Klagesmarktes, an dem sich ein zum Teil versandeter Viehteich befand (der „Ochsenpump“). Georg V. beauftragte Conrad Wilhelm Hase und trug die Kosten für das Bauwerk. Den ersten Entwurf ließ Georg V. vergrößern, außerdem drang er auf eine möglichst würdevolle Gestaltung der Kirche. Das Gebäude entstand in der damals üblichen Ost-West-Ausrichtung mit der Apsis gen Osten und dem Turm nach Westen. Es steht daher schräg zum Klagesmarkt. In Betonung der Sichtachse zum gleichzeitig erbauten Welfenschloss sollte die Straße Am Judenkirchhof ursprünglich westwärts verlängert werden, was jedoch nicht geschah.
Beim Bau der Kirche spielt der 21. September, der Geburtstag des damaligen Thronfolgers Ernst August, eine große Rolle. Die Grundsteinlegung im Jahre 1859, das Richtfest 1861 und die Einweihung, die 1864 durch Konsistorialrat Gerhard Uhlhorn vorgenommen wurde, fanden sämtlich an diesem Jahrestag statt. Auch heute noch wird mit wiederkehrenden Festgottesdiensten an dieses Datum erinnert. Aus praktischen Gründen aber meist in Verbindung mit dem Tag des Offenen Denkmals, an dem mehr Besucherinteresse zu erwarten ist.
Die Skulpturen an Nord-, Süd- und West-Portal wurden um 1860 von den Bildhauern der Kölner Dombauhütte, Christian Mohr, Peter Fuchs und Edmund Renard geschaffen.
Am 1. Mai 1884 wurde die Gemeinde der Apostelkirche als Tochtergemeinde der Christuskirche gegründet, da die Christuskirche für die damals 30.000 Gemeindemitglieder nicht mehr ausreichte.
Ein neues Pfarr- und Gemeindehaus für die Christuskirche wurde im Jahr 1906 erbaut. Karl Börgemann realisierte den Bau gegenüber der Westseite der Kirche, an der Einmündung zur Straße Am Judenkirchhof. Die Fassade ist mit roten Klinkern verblendet und durch grün glasierte Formsteine verziert. Zum Kirchenvorplatz zeigt das Haus einen großen Treppengiebel, zur Straßeneinmündung besitzt es einen turmartigen Eckbau.
Im Verlauf der Luftangriffe auf Hannover während des Zweiten Weltkriegs wurde die 1934 renovierte Kirche mehrmals schwer beschädigt. Der Innenraum mit dem hölzernen Kirchengestühl brannte am 25. März 1945 vollständig aus, ebenso Orgel, Orgelempore und der Glockenstuhl mit den drei mehr als 6 Tonnen schweren Stahlglocken. Die Glocken überstanden den Sturz aus über 20 m Höhe jedoch nahezu unbeschädigt.
Mit dem Wiederaufbau konnte wegen der wirtschaftlich schwierigen Nachkriegsjahre erst 1951 begonnen werden. Die erforderlichen Renovierungsmittel wurden aus Spenden von Gemeindegliedern, Mitteln der Landeskirche und Beiträgen aus dem neu gegründeten Kirchbauverein aufgebracht. Am Heiligabend 1953 fand erstmals wieder ein Gottesdienst statt. Im selben Jahr wurde 1953 als städtebauliches Pendant am anderen Ende des Klagesmarktes das neungeschossige Gewerkschaftshaus des Deutschen Gewerkschaftsbundes Niedersachsen fertiggestellt.
GLOCKEN:
Das aus drei Stahlglocken von 1920 bestehende Geläut erklingt als Vollgeläut zu Festen und Gottesdiensten sowie als viertelstündliche Einzelschläge für das Stundengeläut. Die ursprünglichen vier Bronzeglocken des 1883 vervollständigten Notgeläuts wurden aufgrund Erlass vom 1. März 1917 als kriegswichtiges Material konfisziert und bis auf eine kleine Glocke, die im Juli 1921 nach Ebersgrün veräußert wurde, eingeschmolzen.
a°
JESUS CHRISTUS, GESTERN UND HEUTE, UND DERSELBE AUCH IN EWIGKEIT. IN SCHWERER ZEIT STIFTETE MICH DER OPFERSINN DER GEMEINE ANNO DOM. 1920
c‘
O LAND, LAND, LAND HÖRE DES HERRN WORT!
d‘
FRIEDE SEI MIT EUCH! DIE FRÜHER HINGEN HIER AM ORT DIE GLOCKEN NAHM DER KRIEG HINFORT. NUNMEHR SEI UNS BESCHIEDEN MIT GOTT UND MENSCHEN FRIEDEN!
Gießervermerk auf allen drei Glocken:
GEG. V. BOCHUMER VEREIN I. BOCHUM 1920
Tags
Mehrere Videos parallel von Nürnberger Glockenfreund, Doktor Meisterpeinlich mit ,
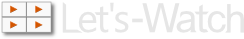



 Springen Zu:
Ton:
Springen Zu:
Ton: